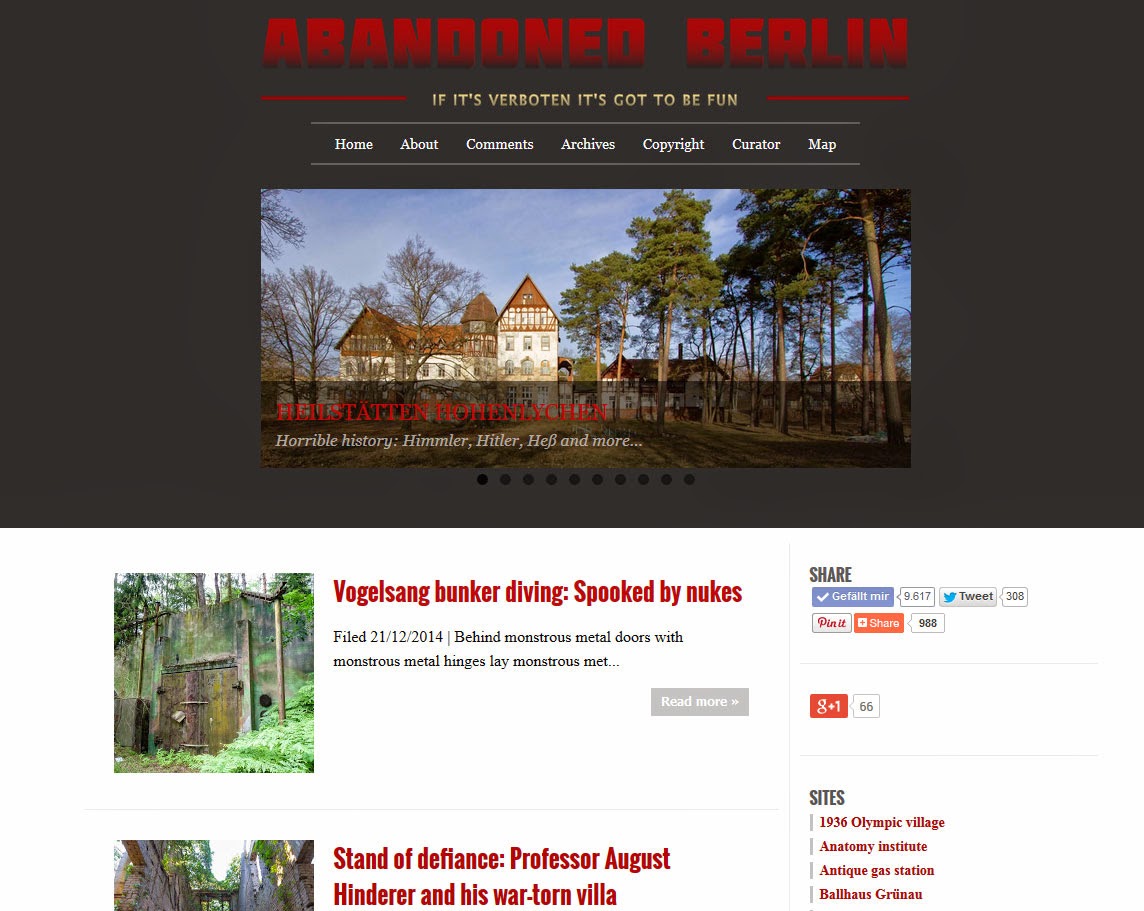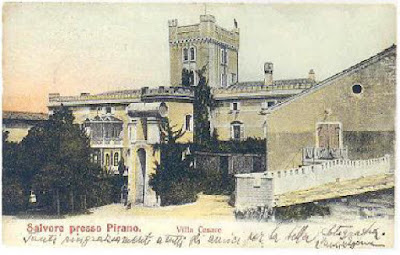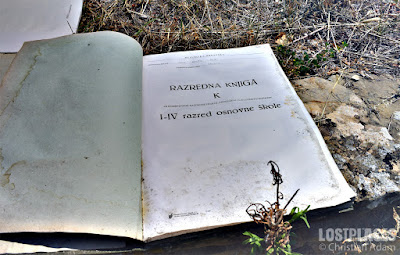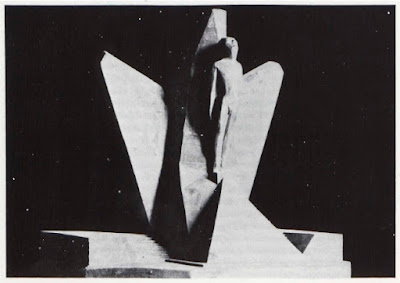Der Bau der Eisenbahnbrücke über die Elbe bei Dömitz ging auf einen Beschluss der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft von 1869 zurück.
![]() |
| Die Dömitzer Eisenbahnbrücke |
Eine neue Eisenbahnverbindung von Wittenberge bis nach Lüneburg sollte entstehen. Dieser Beschluss fand auch die Fürsprache des preußischen Königs Wilhelm. Sein Erlass findet sich in der
„Gesetz-Sammlung für die königlichen preußischen Staaten“ aus dem Jahr 1870 mit folgendem Wortlaut:
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen.
Nachdem die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft in der Generalversammlung ihrer Aktionaire vom 24. November 1869 den Bau und Betrieb einer Zweig-Eisenbahn von Wittenberge über Dömitz und Lüneburg bis zum Anschlusse an die Osnabrück-Bremen-Hamburger Eisenbahn beschlossen hat, wollen Wir der gedachten Gesellschaft zu dieser Erweiterung ihres Unternehmens bezüglich des diesseitigen Staatsgebietes Unsere landesherrliche Genehmigung auf Grund des beigefügten, hierdurch von Uns bestätigten Statutnachtrages ertheilen.
Zugleich wollen Wir der Gesellschaft das Recht zur Expropriation und vorübergehenden Benutzung der für die Bahnanlage erforderlichen Grundstücke nach Maaßgabe der in den einzelnen Landestheilen bestehenden gesetzlichen Vorschriften hierdurch verleihen.
Die gegenwärtige Urkunde ist nebst dem Statutnachtrage durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.
Gegeben Schloß Babelsberg, den 16. Juni 1870.
(L.S.) Wilhelm.
![]()
Der Streckenverlauf wurde geplant, und die Stadt Dömitz, die zu dieser Zeit als stärkste mecklenburgische Landfestung von großer militärstrategischer Bedeutung war, wurde als Standort für die neu zu bauende Elbquerung auserkoren. In der Dömitzer Festung war ein mecklenburgisches Regiment stationiert, in dessen Zuständigkeit nun auch die Verteidigung des Brückenbauwerks fiel. Die Brücke selbst erhielt an jedem Ende ein starkes Bollwerk mit massiven Türmen, Zinnenkranz und Schießscharten zu beiden Seiten der Gleise. Kasemattenähnliche Gewölbe durchzogen das Erdgeschoss. Das am westlichen Ufer gebaute Brückenhaus ist bis heute in nahezu unveränderter Form erhalten geblieben, wie die folgenden Fotos zeigen:
![]() |
| Brückenhaus am westlichen Ufer der Elbe |
Das Brückenhaus auf dem Ostufer der Elbe existiert nicht mehr. Hier ist es allerdings auf zwei alten Postkarten zu sehen:
![]() |
| Die Dömitzer Brücke mit Brückenhaus vom Ostufer aus gesehen |
![]() |
Die Brücke von Dömitz aus gesehen
(Bild von der Infotafel abfotografiert) |
Der folgende Kartenausschnitt zeigt den geplanten (und dann auch realisierten) Streckenverlauf und die Lage der Eisenbahnbrücke bei Dömitz:
In der eingangs schon erwähnten
„Gesetz-Sammlung für die königlichen preußischen Staaten“ findet sich unter
„Vierter Nachtrag“ in §2 noch folgendes zur geplanten Brücke:
[...] Die Elbbrücke bei Dömitz darf höchstens 2000 Schritt von der Zitadelle zu Dömitz entfernt sein und muß eine Drehbrücke [...] enthalten. Außerdem sind zwei Strompfeiler mit Demolitionsminen zu versehen und die beiderseitigen Zugänge der Brücke durch tambourartige Abschlüsse mit Wachtblockhäusern zu sichern.
Hier wird noch einmal die strategische Bedeutung der Brücke deutlich. Der drehbare Brückenteil war zudem nicht nur dazu gedacht, den Schiffen die Passage zu erleichtern sondern auch dazu, die Eisenbahnlinie notfalls ohne großen Aufwand unterbrechen zu können.
Die Dömitzer Eisenbahnbrücke hatte eine Gesamtlänge von 1.050 Meter. Sie bestand neben den beiden Brückenhäusern aus 16 kleinen Brückenbögen à 33,90 m auf dem westlichen Ufer der Elbe, am Ostufer standen 4 dieser Bögen. Dazwischen lag die Drehbrücke mit 38,30 m Länge sowie 4 große Brückenbögen à 67,80 m. Die Bauarbeiten begannen am 8. September 1870 und dauerten bis in den August 1873. Das Ende der Bauarbeiten findet auch Erwähnung in der Dömitzer Stadtchronik:
„Am 29. August 1873 das letzte Niet in die stählernen Rundbögen eingeschlagen.“ Die Inbetriebnahme der Brücke erfolgte schließlich am 18. Dezember 1873, als der erste Personenzug über sie hinweg fuhr.
72 Jahre später, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, kam das plötzliche Ende für die Dömitzer Eisenbahnbrücke. Es war der Nachmittag des 20. April 1945, als die Brücke von fünf amerikanischen Jagdbombern angegriffen wurde. Dabei wurde der östlichste Strompfeiler vor der Drehbrücke so stark beschädigt, dass eine der Stromüberbauten einseitig in die Elbe stürzte. Die Bahnverbindung war damit unterbrochen.
Nach dem Krieg stellte die Elbe an dieser Stelle die Grenzlinie zwischen der Bundesrepublik und der DDR dar. Eine Instandsetzung der Brücke und Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnstrecke wurde zwar einige Male diskutiert, doch selbst nach der Wiedervereinigung nie ernsthaft verfolgt.
Ende 1948 wurden die beschädigten Brückenteile beseitigt. Erst 30 Jahre später, im Juli 1978, ließ die Deutsche Bundesbahn wegen akuter Einsturzgefahr der Strompfeiler die drei verbliebenen Stromüberbauten entfernen und verschrotten. Auch die Strompfeiler selbst wurden abgetragen. Die Reste der Drehbrücke, die östlichen vier Flutöffnungen und der östliche Brückenkopf wurden 1987 im Zuge der Grenzsicherung durch die DDR abgerissen. Die bis heute erhalten gebliebenen 16 Flutöffnungen und der Brückenkopf auf der westlichen Seite stehen unter Denkmalschutz.
Die Eisenbahnverbindung von Wittenberge nach Dömitz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg noch kurz und in stark eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen. Aber bereits im November 1947 wurde diese Strecke endgültig stillgelegt. Die Oberbaumaterialien wurden demontiert und als Reparationsleistung in die Sowjetunion verbracht. Der westliche Streckenteil von der Brücke bis zum Bahnhof Dannenberg Ost diente nach dem Krieg zunächst zum Abstellen beschädigter Güterwagen. Im Jahr 1955 ließ die Bundesbahn auf diesen acht Kilometern die noch relativ neuen Oberbaumaterialien ausbauen und gegen älteres Material ersetzen. Das Gleis wurde aber befahrbar wiederhergestellt. Erst später wurden dann auch hier die Gleise endgültig abgebaut. Der Streckenverlauf lässt sich auch heute noch gut im Gelände nachvollziehen. Vor einigen Jahren konnte man sogar auf dem Damm westlich der Brücke noch die Reste der Holzschwellen finden. Die Eisenbahnlinie von Dannenberg Ost nach Lüneburg wird auch heute noch planmäßig im Personenverkehr bedient. Das östliche Ende der Strecke wird heute durch den Verladekran für die Castor-Behälter markiert. Planmäßiger Güterverkehr findet auf der Strecke seit Januar 1998 nicht mehr statt.
![]() |
| Blick von West nach Ost |
![]() |
| Im Bildhintergrund die nach der Wiedervereinigung neu gebaute Straßenbrücke über die Elbe |
Der noch erhaltene Brückenkopf ist heute ein lohnendes Ausflugsziel und sehenswertes Bauwerk der Industrie- und Verkehrsgeschichte in Norddeutschland. Im April 2010 wurde die Dömitzer Eisenbahnbrücke versteigert. Auf der Internetseite des Auktionshauses Karhausen gab es dazu diese Informationen:
Am Samstag, 10. April 2010, kurz nach 14 Uhr, war es dann soweit: Die historische Dömitzer Eisenbahnbrücke wechselte für 305.000 Euro ihren Besitzer. Per telefonischem Gebot hatte Dr. Tony Bienemann aus Arnheim eines der Symbole deutscher (Teilungs-)Geschichte ersteigert. Verschiedene Ideen zur Nutzung der Brücke hatte der neue Besitzer in den Wochen nach der Versteigerung gesammelt, wie z.B. diese, einen alten Zug auf die Brücke zu stellen und ein Café darin einrichten, oder einen Erlebnispfad für Naturliebhaber mit einem Aussichtspunkt zu schaffen. Bis heute ist allerdings nichts dergleichen realisiert.
Linktipp zu einer sehr interessanten Seite mit vielen Infos und tollen alten und neuen Aufnahmen (nicht nur) zur Dömitzer Eisenbahnbrücke:
Wendland-Archiv.
Quellen: Wikipedia, www.doemitz.de, www.wendland-net.de, Infotafeln vor Ort.
Fotos: Eigene (Oktober 2015) bzw. wie angegeben.