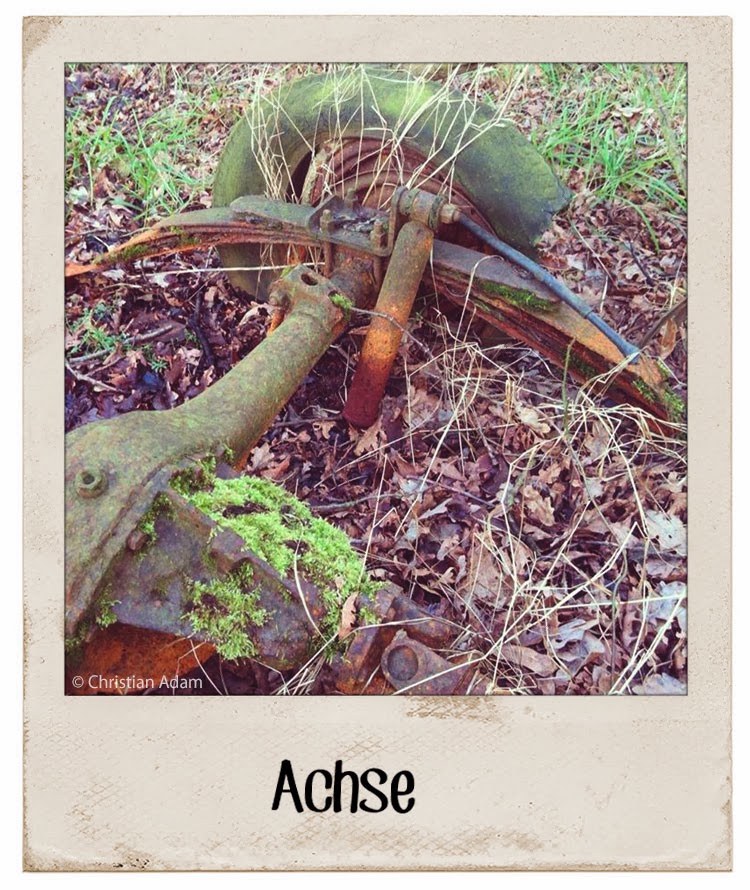![]() |
| Willkommen in Lopau ist man nur bei geöffneter Schranke! |
Am Rande des Truppenübungsplatzes Munster-Nord befindet sich die Ortschaft Lopau, dort, wo der gleichnamige Heidebach mit zwei Quellarmen nordwestlich und östlich des Ortes entspringt. Die Lopau wurde an dieser Stelle schon vor langer Zeit mehrfach aufgestaut, was dem Ort zu einer sehr idyllischen Lage zwischen malerischen Teichen und Seen verhalf.
Emil Stender berichtet darüber in seinen „Wanderungen um Hamburg“ (erschienen 1925; Seiten 121 - 123):
Durch das Lopautal. Eigentlich sollte ich es nicht verraten, wie schön es im Lopautale ist, - aber es sei darum! Denn so erging es mir: Als ich zum erstenmal da unten war im Uelzener Lande - lange vor dem Kriege -, da gab es in Lopau, dem kleinen Orte am gleichnamigen Bache, keine Unterkunftsstätte für müde Wanderer. Nur im alten Schulhause wurden wir gastlich aufgenommen und freundlich bewirtet. Später dann, als ich wiederkam, war aus dem Schulhause eine kleine Wanderer-Herberge geworden. „Zur Bachforelle“ stand darüber. Hier blieb ich für einige Tage und lernte die Umgegend kennen; ich „entdeckte“ so manches versteckte schöne Plätzchen in den Bauernwäldern und Forsten, wurde vertraut mit Förstern und Dorfeingesessenen, saß stundenlang an Fischteichen und Wassern - und sang beim Scheiden das Lob des liebgewordenen Ortes auf allen Wegen. Und das war mein Verhängnis! Denn seitdem ist aus dem Idyll ein vielbesuchter Ausflugs- und Erholungsort geworden - ja, die alte, liebe „Bachforelle“ verschloß mir schon ein paar mal ihre sonst so gastfreundlichen Tore, alldieweil sich meine guten Freunde und Bekannten dort schon vor mir eingenistet hatten. Ihnen allen erging es wie mir: wer sich nur ein paar Tage in den waldumsäumten Wiesen des Lopautales tummeln durfte, wer an den Fischteichen die Abende beim leisen Gesäusel in Schilf und Röhricht verträumen konnte - und dann unter dem Rauschen der alten Dorfeichen zur Ruhe ging, - den zog es später immer wieder dorthin zurück.
![]() |
| Gasthaus "Bachforelle" in Lopau |
![]() |
| Gast- und Pensionshaus "Bachforelle", Lopau, Lüneburger Heide |
![]() |
Der Toepffersche Hof auf einer alten Ansichtskarte,
von Emil Stender einst als „Märchenschloss“ bezeichnet |
[...] Auf schmalen Waldwegen geht es dann weiter dem im Tale liegenden Dorfe Lopau zu. Plötzlich steht ihr vor einem Märchenschlosse. Jawohl - schaut nur hinüber durch das Parkgitter, ob es nicht so ist! Ein malerischer Bau mit Zinnen und Erkern, Altanen und dichtverwachsenen Fenstern und Mauern, überall dabei eine Fülle der herrlichsten Blumen und Blattgewächse auf Treppen und ringsum, - so liegt es vor uns, wie hervorgezaubert aus der tiefen Einsamkeit der durchwanderten Gegend. Es war vor Jahren der Sommersitz eines früheren Magdeburger Großkaufmannes. „Wat ut Aewermann sien Schün all'ns worden is“ - so belehrt uns ein Bild im Hause, und wir erfahren, daß hier ein alter Bauernhof durch die Kunst eines Architekten in dieses prächtige Gebäude umgewandelt wurde. Dem früheren Besitzer gehörten bis zu seinem Ableben die meisten der vielen Fischteiche mit ihren Nebenanlagen, die wir nun weiter sehen werden. Auf weitverzweigten, reizenden Fußpfaden und Waldgängen dürfen wir uns in seinem Besitztum ergehen. Denn das muß gleich zum Lobe dieses Mannes gesagt werden: er sperrte seine Wege nicht ab für Fremde, die des Weges kommen und auch einmal von den intimen Schönheiten einer prächtigen Landschaft kosten möchten - im Gegensatz zu den meisten Reichen, vor deren Besitz uns Stacheldraht und drohende Verbote draußen stehen lassen.
![]() |
| Einer der Teiche bei Lopau in früheren Zeiten... |
![]() |
| ...und heute, im Oktober 2013 |
![]()
Stundenlang können wir auf versteckten Waldwegen und kleinen Fußpfaden die Umgegend von Lopau durchstreifen, und immer werden uns neue Bilder und prachtvolle Ausblicke überraschen. An geeigneten Stellen sind Ruhebänke aufgestellt; ein hoher Aussichtsturm auf vorspringendem Heideabhang am Laufe der Lopau ist auch da; von seiner Rampe aus genießen wir in aller Ruhe den Rundblick über das Lopautal und die umgrenzenden Waldgebiete. Ein Abstecher nach dem nahegelegenen Quellgebiet der Lopau führt uns in eine Wildnis von Wasser, Sumpf und Heidelandschaft, wie sie wohl urwüchsiger kaum zu finden ist. Dazu überall großer Wildreichtum, vom Wassergeflügel aller Art bis zum stolzen Edelherrn unserer Wälder - dem geweihten Hirsch. Hermann Löns hat auf Einladung des früheren Besitzers des Lopauer Hofes dessen weite Jagdreviere waidmännisch eingerichtet; überall sind in den Gehölzen Futterwiesen angelegt und an passenden Stellen Futterraufen aufgestellt. Bei einer Streife durch diese weiten Gebiete finden wir also überall viel Sehenswertes und Interessantes außer der natürlichen Schönheit der Gegend, daß erst ein mehrtägiger Aufenthalt alle Reize des herrlichen Lopautales dem naturfreudigen Wanderer erschließen dürfte! Seine Abgeschiedenheit aber von der großen Heerstraße sichert diesem Gebiet hoffentlich auch noch recht lange seine einzigartige Schönheit!
![]() |
| Karte: Preußische Landesaufnahme |
![]() |
| Der Ortsplan mit den heute noch erhaltenen Gebäuden |
Abgeschieden und einzigartig ist Lopau auch heute, allerdings nicht in dem Sinne, wie es der Autor der vorangegangenen Zeilen sich wünschte. Denn Lopau ist seit den frühen 1980er Jahren ein für die Öffentlichkeit weitgehend gesperrter, verlassener Ort, dem die Nähe zum Truppenübungsplatz Munster-Nord zum Verhängnis wurde.
Was geschehen ist, kann z. B. auf verschiedenen Info-Tafeln im Ort nachgelesen werden: Zunächst profitierte man vom Militär, das seit der Gründung des Truppenübungsplatzes 1893 neben der bestehenden Forstverwaltung ein weiterer wichtiger Arbeitgeber für viele Lopauer wurde. So stieg die Zahl der Einwohner bis zum Zweiten Weltkrieg auf ca. 90 an, und erreichte nach dem Krieg durch Vertriebene und Flüchtlinge mit 276 ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Lopau 13 Häuser.
![]() |
| Zwei Ansichtskarten aus besseren Tagen - abgebildet ist jeweils das Toepffersche Gut |
![]() |
| Blick auf das Toepffersche Gut, wahrscheinlich 1920er Jahre |
Die folgenden Aufnahmen aus einem privaten Fotoalbum sind anlässlich eines Jugend-Pfingstlagers der Reichsfliegerscharen am 9. Juni 1935 in Lopau entstanden (bei ebay entdeckt - leider konnte ich die Originalfotos nicht ersteigern, daher sind hier nur die Bildschirmfotos in geringer Qualität aus der Autktion zu sehen):
Ab 1968 begann man auf dem Truppenübungsplatz mit dem Bau der Schießbahn 7. Nun lag Lopau in deren Gefahren- bzw. Sicherheitsbereich. Für die Einwohner bedeutete dies, dass sie umgesiedelt werden sollten. Alle Proteste nutzten letztlich nichts, es dauerte jedoch noch bis 1983, ehe auch die letzten beiden Bewohner den Ort verlassen mussten.
Einige der Gebäude verfielen nach dem Wegzug der ehemaligen Bewohner und wurden abgetragen. Andere jedoch haben die Zeiten überdauert und stehen noch heute dort, wo sie einst errichtet wurden. Zum Teil ist dies der Bundeswehr und anderen Institutionen zu verdanken, die u. a. den schönen Roth-Hof, den Dehnings-Hof oder auch das Schulgebäude immer noch bzw. wieder nutzen, und somit vor dem Verfall bewahren. Wieder andere Häuser stehen jedoch seit Jahrzehnten leer. Die Fenster und Türen sind verbrettert, damit verhindert wird, dass weder Wind und Wetter noch Vandalen größeren Schaden anrichten können. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man sich heute durch den Ort bewegt. Die Straßen sind zwar intakt - es gibt sogar Laternen - doch der Anblick der verrammelten Häuser und der sich allmählich ausbreitenden wilden Vegetation sorgt für eine merkwürdige Stimmung, die durch die Stille noch verstärkt wird...
![]() |
| (von der Infotafel abfotografiert) |
![]() |
| Die „Dorfstraße“ im Oktober 2013 |
![]() |
| Der Roth-Hof heute |
Für die Informationen zu den folgenden beiden Bildern bedanke ich mich herzlich bei Hermann Aevermann. Er berichtete mir, dass die beiden folgenden Bilder das Verwaltungsgebäude auf Gut Westerhorn zeigen (was aus den Informationen auf der Infotafel leider nicht hervorgeht). Dieses Gut wurde von Toepffer um 1900 südlich von Lopau angelegt, um von hier aus seine Entwicklungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu erproben. Die einsame Lage „mitten im Nichts“ ließ den Bauherrn zu bis dato recht ungewöhnlichen Mitteln greifen: die Gebäude wurden zu einem großen Teil aus Stahlbeton gebaut und nicht, wie sonst zu der Zeit üblich, in Ziegelbauweise. Für die Heranschaffung der Baumaterialien ließ Toepffer sogar eigens eine Feldbahnstrecke vom Bahnhof Brockhöfe nach Westerhorn verlegen. Die Bauten wurden von der Firma Benhöfer aus Hanstedt bei Ebstorf ausgeführt.
![]() |
Gutshaus Westerhorn, erbaut von Toepffer um 1900
(abfotografiert von der Infotafel) |
![]() |
| Aktuelles Luftbild von Westerhorn - zu sehen sind zwei Gebäuderuinen |
Einen ausführlichen Bericht über Westerhorn gibt es hier:
Westerhorn, das Toepffersche Gut.
Bevor ich noch weiter auf die Geschichte des Ortes und einige seiner bekanntesten Einwohner eingehe, hier zunächst ein paar Eindrücke von unserer Entdeckungsreise durch das heutige Lopau:
![]() |
| Eines der verlassenen Häuser in der Nähe des Schulgebäudes |
![]() |
| Ein anderes Haus an der selben Straße |
Und nun, wie angekündigt, hier noch ein Blick in die interessante Geschichte Lopaus. Für die geschichtlichen Fakten sind u. a. die Informationstafeln hilfreich, die an verschiedenen Stellen im Ort aufgestellt sind:
Erstmalig urkundlich erwähnt wurde Lopau im Jahre 1293. Seit 1568 bestand es aus drei Hofstellen. Die Bauern brachten es zu bescheidenem Wohlstand, bis der Ort während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) von schwedischen Truppen geplündert und ein Großteil der Felder verwüstet wurde. Von dieser Not erholten sich die Lopauer Bauern erst Anfang des 18. Jahrhunderts, als der Kartoffelanbau eingeführt wurde, was zu einer Stabilisierung der Ernährungslage beitrug. Doch schon der nächste Krieg, der Siebenjährige Krieg (1756-1763), brachte erneut Zerstörung, Hunger und Seuchen nach Lopau. Auch davon erholte man sich allmählich wieder. Maßgeblich für den erneuten wirtschaftlichen Aufschwung war die Saline Lüneburg, für die nun Holz geschlagen und transportiert werden konnte.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden zwei der drei Lopauer Höfe an den Staat verkauft, den dritten (Aevermannschen Hof mit 625 Hektar Land) erwarb 1895 der Magdeburger Industrielle Richard Toepffer (1840-1919). Wie wohl kein anderer vor ihm und auch nach ihm hat Toepffer Lopau und seine Umgebung geprägt. Toepffer war ein erfolgreicher Dampfpflug-Fabrikant, dessen Anliegen es war, die Leistungsfähigkeit von Dampfpflügen für die Vorbereitung verarmter Böden zur Aufforstung oder Ackerwirtschaft zu demonstrieren. In bzw. um Lopau fand er dazu ideale Bedingungen: er machte mit seinen „Fowlerschen Dampfpflügen“ das karge Heideland urbar und forstete Teile seines Besitzes auf. Sogar Hermann Löns, der berühmte Heidedichter, erwähnt Lopau in seinem Buch „Haidbilder“, und berichtet über die Kultivierung der großen Heideflächen folgendes:
„Wenn man von Lopau, das da hinten in der Haide zwischen Ülzen und Munster liegt, den Hützeler Weg entlang geht [...] Bevor der Dampfpflug hier das Land um und um wühlte und den Boden für die Fuhren zurecht machte [...] war da alles kahle Schnuckenheide [...]“
Davon zeugt noch heute die Landschaft rund um den sogenannten „Töpferturm“, ein Aussichtsturm, der ursprünglich dreistöckig war und als Herrengästehaus diente. Man konnte von dort einst über die frisch aufgeforsteten Flächen bis nach Munster blicken, und immernoch sind die rund vier Meter breiten Bodenwellen als Relikte dieser Arbeiten zu erkennen. Mitte der 1970er Jahre wurde der heutige neue Turm errichtet, der Wanderern als Rastplatz dient.
An dem Wanderweg befindet sich auch das sogenannte „Froschmaul“, ein gewaltiger Findling, der angeblich durch den „Fowlerschen Dampfpflug“ gespalten worden sein soll.
![]() |
| Die Alte Forstwartei auf dem ehemaligen Toepfferschen Gut |
![]() |
| Die ehemalige Waschküche |
Toepffer trug auf seinem Gut das alte Bauernhaus wegen Baufälligkeit ab, ließ eine Scheune zu seinem neuen Wohnhaus umbauen und gestaltete das Areal insgesamt zu einem repräsentativen Landsitz. Er sanierte die übrigen Gebäude auf dem Hof und errichtete weitere, in denen er auch die zahlreichen Arbeitskräfte unterbrachte, die er für seine Arbeiten benötigte. Außerdem legte er in und um Lopau herum mehrere Fischteiche an und war wohl Initiator für den Neubau der Schule. Nach Toepffers Tod wurden seine Besitzungen 1922 an den Staat verkauft. 1942 erhielt der damalige Gauleiter von Ost-Hannover und Reichsverteidigungskommissar Otto Telschow den Toepfferschen Hof und 40 ha Land als Treuegeschenk. Telschow ließ in unmittelbarer Nähe einen Betonbunker errichten, dessen Reste noch bis heute unter einem Erdhügel erhalten sind.
Von den damals umgebauten und neu errichteten Gebäuden sind heute jedoch nur noch das (nach dem letzten Besitzer benannte) „Haus Schilling“, das zu Toepffers Zeiten der Aufseherfamilie als Wohnung diente, sowie die „Alte Forstwartei“ (in der früher die Waldarbeiter lebten), und eine ehemalige Waschküche erhalten. Das einst so stolze und prächtige Haupthaus Toepffers ließ die Bundeswehr 1978 abreissen.
![]() |
| (von der Infotafel abfotografiert) |
![]() |
| Ein paar Überreste der Umzäunung sind noch erhalten |
![]() |
Zwischen diesen Bäumen fuhr man einst direkt auf das prächtige Wohnhaus zu,
heute ist davon nichts mehr zu sehen |
![]() |
| Hier stand bis 1978 das Toepffersche Wohnhaus |
Neben einigen Wohnhäusern ist bis heute aber auch das um 1900 errichtete neue Schulgebäude erhalten. Aufgrund seines Baustils, der den Häusern auf dem Toepfferschen Gut ähnelt, wird angenommen, dass Toepffer der Initiator für diesen Schulneubau war. Bereits 1963 wurde die Schule geschlossen.
![]() |
| Die Schule in Lopau auf einer Postkarte aus den 30er Jahren |
![]() |
| (von der Infotafel abfotografiert) |
![]() |
| Die Lopauer Schule |
![]() |
| „Bitte drehen“ - doch seit 1963 öffnet sich diese Tür leider nicht mehr |
![]() |
| Diensttelefon der Bundeswehr - besser nicht benutzen! |
![]() |
| Durch diese Tür stürmten die Schüler damals wohl auf den Pausenhof |
![]() |
| Die Rückansicht des Schulgebäudes |
![]() |
| Ein Schuppen gegenüber der Schule |
![]() |
| Ein faszinierender Blick vom Schulgelände in die angrenzende Natur |
Der ehemalige „Lopau-Hof“, dem der Ort wohl seinen Namen zu verdanken hat, existiert ebenfalls noch. Hier war der Familienname Lopau noch bis 1790 nachweisbar. 1883 ging der Hof an den Hannoverschen Provinzialfiskus und 1935 schließlich an das Deutsche Reich über. Bis zur Räumung Lopaus diente der Hof dem Bundesforstamt Raubkammer als „Revierförsterei Fangbeutel“. Heute ist er im Bundeseigentum und wird von der Stadt Munster mitbenutzt.
![]() |
| Die ehemalige Försterei Fangbeutel |
Ein wenig abseits im Wald liegt noch heute die ehemalige Försterei Herzberge. Die vier Gebäude sind noch recht gut erhalten und werden oder wurden zumindest bis vor kurzen noch genutzt. Hier ein paar Eindrücke:
![]() |
| Ehemalige Försterei Herzberge |
Hier gibt es noch einen interessanten Film über Lpopau von der LANDESZEITUNG für die Lüneburger Heide zu sehen:
Lostplaces - Das Geisterdorf LopauQuellen (in Auszügen): Wikipedia; geschichtsspuren.de; savmunster.de; Buch „Raus ins Grüne!: die schönsten Wald-Wanderungen in Niedersachsen“ (Schlütersche Verlagsgesellschaft 2006); Fotos: eigene; alles andere wie angegeben.